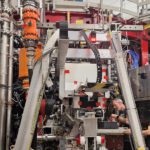Anfang Juli hatte ich die Gelegenheit, das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München zu besuchen – eines der weltweit führenden Forschungszentren für Fusionsenergie. Im Mittelpunkt meines Besuchs stand die Besichtigung der Tokamak-Experimentieranlage ASDEX Upgrade. Diese Anlage gehört zur internationalen Spitzengruppe der Fusionsforschung und leistet einen wichtigen Beitrag für das internationale Großprojekt ITER, das derzeit in Südfrankreich gebaut wird. Finanziert wird ASDEX Upgrade maßgeblich aus Mitteln des Bundesforschungsministeriums.
Tokamaks wie ASDEX Upgrade arbeiten mit starken Magnetfeldern, die ein extrem heißes Plasma – ein Gas aus elektrisch geladenen Teilchen – in einem ringförmigen Vakuumbehälter stabil einschließen. Im Inneren herrschen Temperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius – Bedingungen, unter denen Wasserstoffkerne zu Helium verschmelzen können und dabei gewaltige Energiemengen freisetzen. Anders als bei der Kernspaltung entstehen dabei kaum langlebige radioaktive Abfälle, und es besteht kein Risiko einer nuklearen Kettenreaktion – ein enormer Sicherheitsvorteil.
In einem spannenden Austausch mit den beiden wissenschaftlichen Direktoren Prof. Dr. Frank Jenko und Prof. Dr. Ulrich Stroth diskutierten wir die Perspektiven dieser Technologie. In den letzten Jahren ist die Kernfusionsforschung ihrem Ziel, einen Nettoenergiegewinn zu erzielen, immer näher gekommen. Und kürzlich gelang dies erstmals in einem US-amerikanischen Laserexperiment – ein Meilenstein. Trotzdem aber noch deutlich entfernt von einem kommerziell nutzbaren Kraftwerk.
Beide Experten sind überzeugt: Es lohnt sich, diesen Weg zielstrebig weiter zu verfolgen — auch wenn es voraussichtlich noch etwa zwei Jahrzehnte dauern wird, bis das erste Kernfusionskraftwerk tatsächlich Strom ins Netz einspeisen kann. Der weltweite Bedarf an Primärenergie wird noch bis Ende dieses Jahrhunderts und vermutlich darüber hinaus stark steigen – allein deshalb ist es sinnvoll, heute in die Entwicklung zukünftiger Optionen wie die Fusion zu investieren.
Erfreulich war, wie international und lösungsorientiert die Wissenschaftler*innen am Max-Planck-Institut zusammenarbeiten – etwa bei der Frage, wie mit den verbleibenden, wenn auch deutlich geringeren radioaktiven Abfällen umzugehen ist. Es ist richtig und wichtig, auch diese Aspekte vor Inbetriebnahme kommerzieller Anlagen umfassend zu klären.
Mein Fazit nach dem Besuch: Die Forschung an der Kernfusion verdient unsere volle Unterstützung – aber ebenso einen realistischen Blick auf ihre zeitliche Perspektive. Für die Energieversorgung von morgen brauchen wir vor allem jetzt den raschen Ausbau der Erneuerbaren – aber längerfristig kann die Fusion wahrscheinlich einen wichtigen Beitrag zur Deckung des ständig wachsenden weltweiten Energiebedarfs leisten.